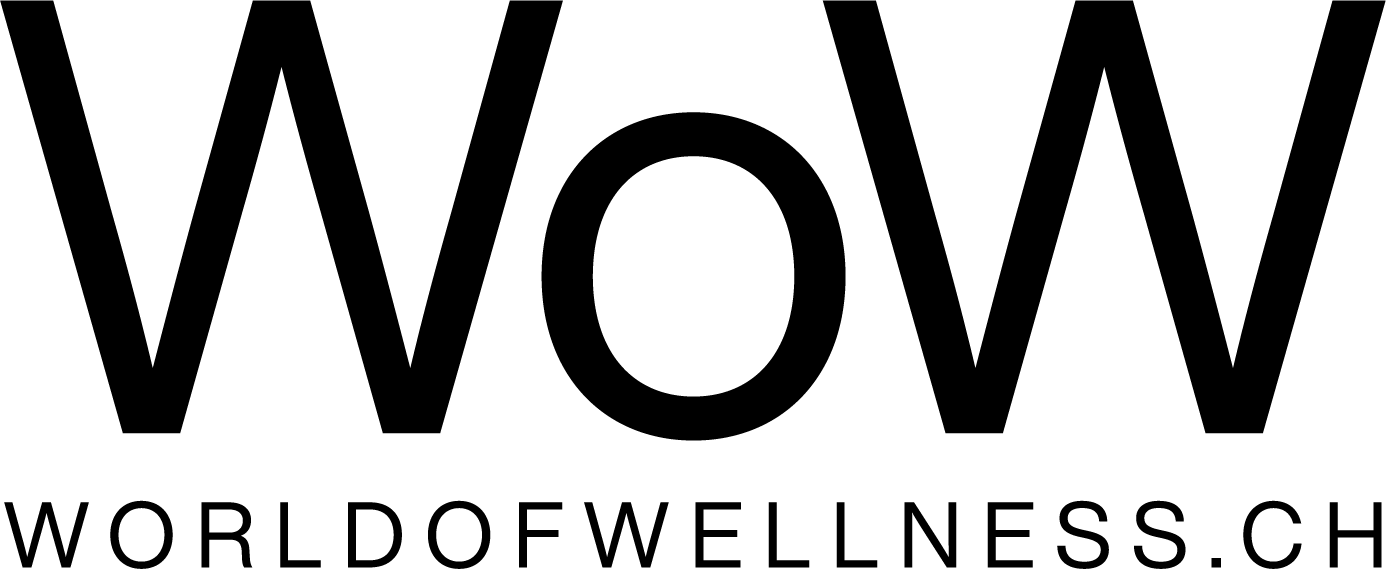Kein Händeschütteln zur Begrüssung, keine Umarmungen unter Freunden in Zeiten des Social Distancing – aber schon kleine Berührungen sind wichtig für unsere Beziehungen. Professor Martin Grunwald, Leiter des Haptiklabors an der Universität Leipzig, erklärt im Rahmen der Themenwoche «Arte berührt» mit Forschern aus Schweden, England und Frankreich, wie Berührungen die physische und kognitive Entwicklung, aber auch unser tägliches Leben prägen.
Sanfte Berührungen sind lebenswichtig für uns Menschen. Sie schaffen für Babys den ersten Kontakt zur Welt und geben ein Gefühl der Sicherheit und Zugehörigkeit. Sie beeinflussen, wie wir Stress oder Schmerzen wahrnehmen, wie gut unser Immunsystem funktioniert, wem wir vertrauen. Eine Berührung kann einen Menschen selbst dann noch erreichen, wenn er kaum mehr mit der physischen Welt verbunden ist. Vor allem starke Gefühle wie Liebe oder Mitgefühl können über Berührungen besser vermittelt werden als durch Worte, Mimik oder Gestik.
«Wir können Berührungsreize nicht einfach ignorieren», erklärt Psychologe Martin Grunwald, der seit mehreren Jahrzehnten zu taktilen Reizen forscht und schon 1996 das Haptiklabor am Paul-Flechsig-Institut der Medizinischen Fakultät gründete. Dort untersuchen Leipziger Wissenschaftler, wie sich die Gehirnaktivität unter einer Körpermassage verändert und warum wir uns täglich bis zu 800-mal unbewusst ins Gesicht fassen.
«Einfach nur durch Berührungsreize verändert sich die Biochemie unseres Gehirns auf dramatische und positive Art und Weise», sagt Grunwald. «Es macht uns krank, wenn Berührungen dauerhaft fehlen. Aber der Bedarf an Berührungen ist individuell unterschiedlich. Jeder braucht hier seine eigene Dosis», so der Psychologe.
Durch Berührungen wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Dieses gesundheitsfördernde Hormon hat beruhigende und auch wachstumsfördernde Wirkungen und kann Immunreaktionen des Körpers beeinflussen. «Es ist eine ganz vielfältig wirksame Substanz», führt Grunwald in der ARTE-Doku aus. «Wenn Berührungsreize zu lange fehlen, können körperliche und psychische Schäden auftreten.»
Was das Social Distancing mit der einhergehenden Berührungsarmut mit uns Menschen macht, darüber können die Forscher derzeit nur spekulieren. Bekannt ist, dass dauerhafte Einsamkeit so schwere Folgen nach sich ziehen kann wie der Konsum von Nikotin und Alkohol.
WARUM TUN BERÜHRUNGEN SO GUT?
Das hat mit den Reaktionen im Körper zu tun. Die Körper-Grenze zur Aussenwelt und damit auch die Oberfläche, an der wir angefasst werden, ist die Haut. Sie ist das grösste Organ des Körpers und enthält Millionen von Berührungsrezeptoren. Mit ihnen spüren wir Wärme und Kälte, Strukturen, Texturen und Druck, aber auch die Richtung und Geschwindigkeit von Berührungen. Von den Haut-Rezeptoren aus werden die Signale über Nervenbahnen an das Gehirn geschickt. Dabei werden aber nicht nur die harten Fakten übermittelt wie Struktur und Ort der Berührung, sondern über eine spezielle Nervenverbindung auch eine emotionale Bewertung der Berührung. Ist die Berührung positiv oder negativ, angenehm oder unangenehm?
Diese Verbindung, über die Berührungen Gefühle auslösen, besteht aus den sogenannten CT-Nervenbahnen. Sie werden nur bei relativ sanften und langsamen Streichel-Bewegungen aktiviert und reagieren besonders gut auf Hautwärme. Im Gehirn führt ihre Aktivierung zur Ausschüttung des Glückshormons Oxytocin. Ausserdem verändert sich die Empfindlichkeit für Endorphine, einer Gruppe körpereigener Opiate. In der Folge kommt es zum Abbau von Stresshormonen und der Verlangsamung von Atmung und Herzschlag. Der Körper entspannt sich und wir fühlen uns wohl. So können Berührungen unsere Gefühle formen. Um die genauen Prozesse und alle Effekte von Berührungen zu verstehen, braucht es aber noch mehr Forschung. Unter anderem zu den Details der neurobiologischen Prozesse.
WAS PASSIERT, WENN MAN NICHT BERÜHRT WIRD?
2016 waren um die 20 Millionen Deutsche alleinstehend. Wer einsam ist und ohne Partner lebt, hat Studien zufolge eine kürzere Lebenserwartung und eine höheres Krankheitsrisiko. Das könnte auch mit dem Mangel an Körperkontakt zusammenhängen, unter dem diese Menschen oft leiden. Denn lange Umarmungen und intensiven Körperkontakt gibt es in der westlichen Kultur hauptsächlich in romantischen Beziehungen. Stattdessen Freunde oder Bekannte zu berühren, kann schnell zu einem ganz anderen Effekt führen als dem Aufbau von Vertrauen und dem Abbau von Stress. Gegenseitiges Einverständnis sollte hier immer an erster Stelle stehen. Wer keinen menschlichen Kuschelpartner hat, muss aber nicht verzweifeln. Studien haben gezeigt, dass auch das Streicheln von Hunden zu Endorphin-Ausschüttung führt und Stress abbaut. Wie wäre es denn mit einem Haustier? – Für alle anderen gilt: einmal am Tag 20 Sekunden umarmen. Das gehört genauso ins Gesundheits-Repertoire wie der tägliche Apfel.